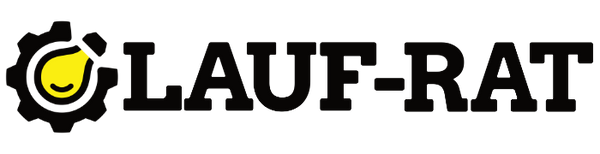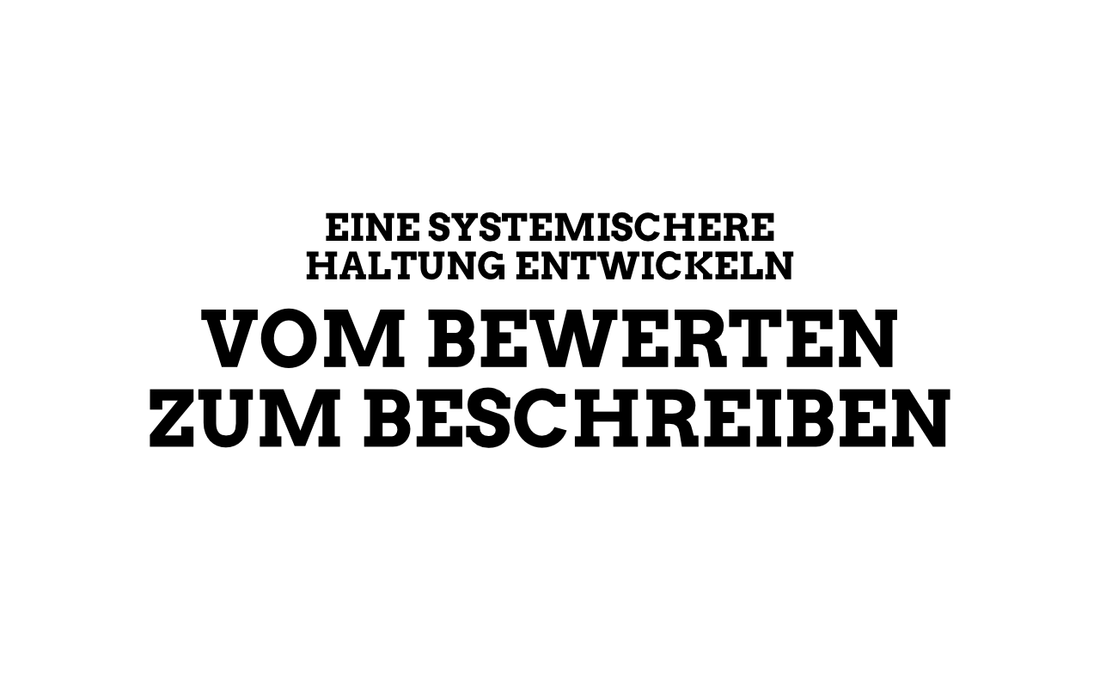
Vom Bewerten zum Beschreiben – eine systemischere Sichtweise entwickeln
Share
Wir alle kennen diese Situation: Jemand tut oder sagt etwas – und sofort schießt uns ein Urteil durch den Kopf. „Das war falsch. Das war unprofessionell. Das war schlecht.“
Solche Bewertungen sind menschlich, doch sie verengen die Sichtweise und machen uns blind für andere Deutungen.
In der systemischen Haltung versuchen wir genau das zu vermeiden. Statt vorschnell zu bewerten, treten wir einen Schritt zurück und bleiben beim Beobachten und Beschreiben:
- Was habe ich gesehen?
- Was habe ich gehört?
- Was war vielleicht auch anders, als ich zunächst dachte?
Dieses Zurücktreten eröffnet neue Handlungsspielräume und schafft Raum für Hypothesenvielfalt.
Von Zuschreibungen zu Hypothesenvielfalt
Oft neigen wir dazu, von einem Verhalten auf ein Problem zu schließen – manchmal sogar bis hin zu Diagnosen oder pathologischen Zuschreibungen. Diese Festlegungen können zwar Orientierung geben, engen aber häufig unnötig ein.
In der systemischen Beratung wird versucht, ein umfassenderes Bild jenseits von Zuschreibungen zu ermöglichen. Insa Sparrer und Matthias Varga von Kibéd sprechen dabei sogar komparativisch von einem „systemischeren“ Handeln, da der Begriff„systemisch“ auch wieder eine Zuschreibung wäre. Vielmehr geht es darum Bewertungen aufzulösen und mehrere Deutungen nebeneinander bestehen zu lassen.
Das gelingt am besten, wenn wir ins Beobachten und Beschreiben zurückkehren. Bewertungen werden dadurch „flüssiger“ und starr gewordene Zuschreibungen lösen sich auf.
Ein Beispiel aus der Praxis
Statt zu sagen: „Das war unprofessionell“, könnte die beschreibende Variante lauten:
- „Es gab viele Unterbrechungen, die haben mich beim Zuhören rausgebracht
- „Du hast nach Worten gerungen, deshalb wirkte deine Sprache etwas stockend.“
Die Unterschiede sind deutlich: In der Bewertung wird die Person festgelegt, in der Beschreibung bleibt Raum für alternative Deutungen und neue Möglichkeiten.
Eine einfache Übung für Gruppen
Diese Haltung lässt sich gut in Übungen trainieren. Ein Beispiel:
- In einer Gruppe wird ein Alltagsgegenstand (z. B. ein Ball) herumgereicht.
- Schritt 1: Alle beschreiben reihum, was sie sehen („Der Ball ist rund, bunt, rot-grün…“).
- Schritt 2: Danach überlegen sie mögliche Erklärungen („Vielleicht ist er bunt, damit Kinder ihn mögen“).
- in einem dritten Schritt kann ein persönliches Urteil ausgesprochen werden („der Ball ist zum Spielen gut geeignet, aber mein Geschmack ist es nicht").
Schnell wird klar: Reine Beschreibungen halten uns im Beobachten, während Erklärungen und Bewertungen bereits Zuschreibungen sind. Die Übung zeigt spielerisch, wie leicht wir ins Urteilen rutschen – und wie bewusstes Beschreiben neue Offenheit schafft.
Fazit: Sprache schafft Spielraum
Schon kleine Veränderungen in unserer Sprache können Großes bewirken.
Wenn wir vom Bewerten ins Beschreiben wechseln, treten wir einen Schritt zurück, schaffen neue Hypothesenräume und ermöglichen uns selbst wie auch anderen mehr Handlungsspielraum.